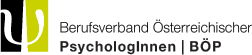ExpertInnen diskutierten „Licht und Schatten von Social Media“
Psychologie leistet wichtigen Beitrag zur Medienkompetenz

Mit den Chancen und Risiken im Alltagsleben und den Konsequenzen vor allem für Kinder und Jugendliche befassten sich am 21.9.2015 ExpertInnen bei der Fachenquete „Social Media: Licht und Schatten aus psychologischer Sicht“, bei der mehr 180 ExpertInnen anwesend waren. Eröffnet wurde die Enquete von Bundesministerin Sophie Karmasin und Sandra M. Lettner, Präsidentin des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen.
Millionen Menschen twittern, bloggen, chatten und posten in jeder freien Minute. Schnell ist von "Internetsucht" die Rede. Haben wir es hier tatsächlich mit einer Massensucht zu tun? Das Internet per se macht nicht süchtig, sind sich PsychologInnen einig. Es verführt jedoch eher zu Suchtverhalten, weil die "Suchtmittel" wie Smartphone, Tabletts oder Computer Teil unseres täglichen Lebens und somit jederzeit und überall verfügbar sind.
„Durch Soziale Medien entsteht ein neues Kommunikations- und Informationsverhalten. PsychologInnen wissen um die daraus resultierenden neuen gesellschaftlichen Phänomene und können über Risiken der „Social Media-Nutzung“ aufklärend und beratend tätig sein. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zu einer gesunden „Medienkompetenz“, so Sandra Lettner, Präsidentin des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen, in ihrer Eröffnungsansprache.
Leiden Menschen bereits an den Folgen einer übermäßigen Social Media-Nutzung, wie an Spielsucht, an Mangel an persönlichen Sozialkontakten oder unter Cybermobbing, sind es PsychologInnen, die mittels klinisch-psychologischer Behandlung helfen können.
Die „Umkehr des Wissenstransfers“ hob Bundesministerin Sophie Karmasin in ihrer Eröffnungsrede hervor und meinte damit die höhere Kompetenz von Kinder in der Nutzung von Internet und Sozialen Netzen gegenüber der Erwachsenengeneration. Genau diese Umkehrung stelle sowohl Eltern als auch PädagogInnen vor große Herausforderungen, wenn es um elterliche Autorität in der Erziehung ginge. In dem Zusammenhang stellte Karmasin „dig4Familiy“ vor, eine Webinar-Reihe mit der die Medienkompetenz in Familien gestärkt werden soll.
„Durch Soziale Medien entsteht ein neues Kommunikations- und Informationsverhalten. PsychologInnen wissen um die daraus resultierenden neuen gesellschaftlichen Phänomene und können über Risiken der „Social Media-Nutzung“ aufklärend und beratend tätig sein. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zu einer gesunden „Medienkompetenz“, so Sandra Lettner, Präsidentin des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen, in ihrer Eröffnungsansprache.
Leiden Menschen bereits an den Folgen einer übermäßigen Social Media-Nutzung, wie an Spielsucht, an Mangel an persönlichen Sozialkontakten oder unter Cybermobbing, sind es PsychologInnen, die mittels klinisch-psychologischer Behandlung helfen können.
Die „Umkehr des Wissenstransfers“ hob Bundesministerin Sophie Karmasin in ihrer Eröffnungsrede hervor und meinte damit die höhere Kompetenz von Kinder in der Nutzung von Internet und Sozialen Netzen gegenüber der Erwachsenengeneration. Genau diese Umkehrung stelle sowohl Eltern als auch PädagogInnen vor große Herausforderungen, wenn es um elterliche Autorität in der Erziehung ginge. In dem Zusammenhang stellte Karmasin „dig4Familiy“ vor, eine Webinar-Reihe mit der die Medienkompetenz in Familien gestärkt werden soll.
Social Media sind weiblich
Christian Montag, Professor an der Universität Ulm, hob in seinen Hauptvortrag hervor, dass Social Media weiblich sind. So nutzen Mädchen und Frauen WhatsApp 40 min am Tag, Burschen und Männer hingegen nur 27 Minuten. Zu einer problematischen Internetnutzung (von Internetsucht wollte Montag ebenso wenig sprechen wie die anderen Vortragenden), kommt es eher, wenn die Fähigkeit zur Selbstregulation eingeschränkt ist. Menschen mit guter Selbstregulation verbringen weniger Zeit im Internet und sind signifikant weniger anfällig für problematische Internetnutzung. Diese liegt übrigens in Deutschland bei 1% hingegen in Asien bei 7%.
Montag zeigte auch auf, dass ein sinnvoller Technologieeinsatz im Arbeitsleben jedenfalls produktiver macht, jedoch nur, wenn ein paar Regeln beachtet werden. So sinkt die Arbeitsleistung, wenn der Alltag durch die permanente Nutzung von Kommunikationstechnologien zu sehr fragmentiert wird. Eine Empfehlung von Montag ist unter anderem, E-Mails nur dreimal pro Tag abzurufen und nicht laufend. Das ermöglicht eine Konzentration auf andere Tätigkeiten, die nicht von laufend eingehenden e-Mails unterbrochen werden. Interessant war auch sein Hinweis, dass das Smartphone Armbanduhr und Wecker zu einem hohen Anteil ersetzt hat. Die Problematik dessen offenbart sich erst auf den zweiten Blick: ist das Smartphone auch die Uhr oder gar der Wecker in der Früh, steigt die Wahrscheinlichkeit stark an, dass man nicht nur auf die Uhr schaut, sondern auch gleich e-Mails liest und schickt SMS. Und so den Tag stressig beginnt.
Internetnutzung beginnt bei den 3-6Jährigen
Philipp Sinner, Universität Salzburg, ging konkret auf die Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen ein und präsentierte die Ergebnisse der Studie „EU-Kids Online“. Demnach nutzen bereits 41% der 3-6-jährigen das Internet in Form von Videos, Fotos und Spiele.
Interessant auch sein Hinweis, dass viele Eltern eine hohe Hemmschwelle haben, in die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder, vor allem wenn diese ins Teenageralter kommen, einzugreifen. Gleichzeitig unterschätzen sie die Risiken, denen Kindern in sozialer Netzwerke begegnen.
Weiters wies Sinner darauf hin, dass die Kompetenzen der Kids bei der Mediennutzung in den letzten Jahren zwar angestiegen sind, jedoch nicht in dem Ausmaß, wie man aufgrund von Schulungen erwartet hätte. Daher sind Eltern und PädagogInnen weiterhin gefordert, Kinder und Jugendliche beim Erlernen der Medienkompetenz im Umgang mit Internet und sozialen Medien zu unterstützen.
Interessant sind auch die Antworten junger InternetnutzerInnen, was diese im Internet am meisten stört. Hier wurde in erster Linie die massive reale Gewalt und Pornographie – v.a. Pornographie in Verbindung mit Gewalt an Frauen – genannt. Fiktionale Gewalt, also in Form von Spielen oder Filmen hingegen, empfinden die Kinder als nicht belastend. Hier kann offenbar gut zwischen fiktionaler und realer Gewalt unterschieden werden.
Social skills trotz Social Media? Sozial Schwächere profitieren jedoch deutlich weniger
Soziale Fähigkeiten lassen sich auch in den Sozialen Medien erlernen und trainieren. Zu diesem Schluss kommt die Klinische- und Gesundheitspsychologin Martina Genser-Medlitsch, Leiterin des Familien- und Beratungszentrums Baden. Kritikfähigkeit, Durchhaltevermögen, Empathie und Verantwortungsgefühl, nur um ein paar zu nennen, sind wesentlich, um Social Media förderlich nutzen zu können..
Gleichzeitig bietet das Internet auch eine Plattform, um diese Kompetenzen zu trainieren. Doch dazu brauchen Kinder Unterstützung. Gerade bei Kindern aus sozial schwächeren Familien ist dieser Beistand jedoch häufig nicht vorhanden. Zwar bekommen diese Smartphones oder Computer sehr wohl geschenkt, werden dann aber von Eltern nicht mehr unterstützt, um einen förderlichen Umgang damit auch zu erlernen. Hier stellt eine Gefahr dar, in eine problematische Internetznutzung zu rutschen.
Genser-Medlitsch plädierte dafür, dass Eltern mit ihren Kinder Zeiträume festgelegen, in dem diese surfen, chatten und posten können, um danach die Aufmerksamkeit wieder auf andere Tätigkeiten, z.B. Hausübung oder das gemeinsame Abendessen, zu lenken. Damit greift auch sie den Vorschlag von Christian Montag auf, auch bei Kinder darauf zu achten, den Tag durch die permanente Nutzung von Internet, WhatsApp & Co nicht zu sehr zu fragmentieren.
Problematische Internetnutzung durch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale vorhersagbar
Christoph Augner vom Gesundheitsforschungsinstitut des Universitätsklinikums Salzburg, hob in seinem Vortrag gewisse Verhaltens- bzw. Persönlichkeitsmerkmale hervor, die eine problematische Internet- bzw. Smartphone-Nutzung wahrscheinlich machen. Vor allem emotional instabile Personen oder Menschen mit höherer Ängstlichkeit und höheren Depressivitätswerten nutzen das Internet und Soziale Medien in ungesundem Ausmaß. Auch ist bei Betroffenen pathologisches Essverhalten, schlechtere Schlafqualität (oftmals bedingt durch eingehende Anrufe oder Nachrichtentöne in der Nacht), negatives Coping-Verhalten und chronischer Stress feststellbar.
Auch er weist auf die sozialen Unterschiede hin, die ein wesentlicher Einflussfaktor sind, ob das Internet und soziale Medien Chancen oder Risiken in sich bergen. Laut seiner Erfahrung tappen sozial benachteiligte Menschen eher in problematische Internetnutzung. Um dem entgegenzuwirken empfiehlt Augner handyfreie Zeiten. Er hält es für wichtig, dass im Umgang mit Internet und sozialen Medien eine Kultur entwickelt ist, in dem man erkennt, in welchen Situationen die Nutzung von Smartphone & Co. unterlassen werden sollte, und wann es getrost genutzt werden kann. Dazu gehört auch, ein Gefühl für Privatheit und Öffentlichkeit zu entwickeln: wann stören Handygespräche im öffentlichen Raum, welche Informationen gibt man in der Öffentlichkeit preis und gehört das auch dorthin?
Auch Digital Natives brauchen Unterstützung und Empowerment
Gibt es überhaupt „Digital Natives“? Nein, denn moderne Technologien ändern sich in rasendem Tempo, sodass es nicht einfach nur reicht, in die digitale Zeit hineingeboren zu sein. Diese provokative These stellte Barbara Buchegger von Saferinternet.at an den Anfang ihres Vortrages. Und damit gab sie auch schon das wichtige Thema „Unterstützung und Stärkung“ vor: nicht das Beherrschen der Technik ist die Herausforderung im Umgang mit Internet und sozialen Medien, sondern die emotionale Stärkung und Unterstützung der NutzerInnen, damit sie schneller in der Lage sind, Gefahren im Internet zu erkennen und sich selbst zu schützen.
Cybermobbing und Sexting heißen zwei Begleiterscheinungen in der Welt der Sozialen Netzwerke. Sexting, also das Verbreiten von eigenen Nacktfotos, gehöre aber laut Buchegger zur jugendlichen Lebenswelt und wird im Allgemeinen selten zum Problem – aber dann ein immenses. Bisher haben sich Jugendliche mit dem Versenden von eigenen Nacktfotos jedoch strafbar gemacht. Das wird sich vermutlich mit dem 1. Jänner 2016 ändern, wenn die Strafgesetzbuch-Reform in Kraft tritt.
In Bezug auf Cybermobbing hebt Buchegger hervor, dass „Kinder nicht nur wehrlose Opfer sind. Sie sind manchmal Opfer, aber oft sind es die Personen, die mitbekommen, was anderen passiert – und sie sind auch die Täter, die es anderen antun". Als Beispiel nennt sie das Phänomen „Happy Slapping“. Dabei werden körperliche Angriffe z.B. auf MitschülerInnen fotografiert und im Internet verbreitet, was eine Form des Cybermobbings darstellt. Laut Buchegger ist zu befürchten, dass dieser Trend, der in anderen Ländern schon vermehrt auftritt, mit einer Zeitverzögerung auch in Österreich ankommen wird. Mit den neuen Bestimmungen im Strafgesetzbuch - § 107c StGB – wird ab 1.1. 2016 der Tatbestand von Cybermobbing strafbar.
Radikalisierung über das Internet: ein brandaktuelles Phänomen
Radikale Gruppierungen, sei es links-, rechtsextrem oder jihadistisch, nutzen Social Media und das Internet zur Rekrutierung von Gleichgesinnten. Verena Fabris von der Beratungsstelle Extremismus des Bundesministeriums für Familien und Jugend weiß, wie geschickt hier vorgegangen wird. „Auf Youtube, Facebook oder Twitter vermitteln sie den Jugendlichen: Bei uns kannst du Geschichte schreiben, ein Held, eine Heldin sein.“, so Fabris und verweist damit darauf, dass letztendlich Identität und Gemeinschaftsgefühl geboten wird. Verknüpft mit der Abwertung anderer Gruppen werden Gefühle von Stärke, Überlegenheit und Selbstwirksamkeit vermittelt.
In Anlehnung an die Streetworker wäre es auch in Sozialen Netzwerken hilfreich, „Online-Streetworker“ anzubieten. Als Beispiel nennt Fabris das Projekt „Was postest Du? Politische Bildung mit jungen MuslimInnen online“, das sich mit politischer Bildung im Web mit aktuellen Fragestellen der muslimisch sozialisierten Jugendlichen im Alltag beschäftigt und damit einen präventiven Beitrag im Vorfeld möglicher Radikalisierungsprozesse leisten.